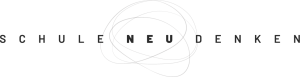Entspannt unterrichten… wie geht das? Hier teile ich erneut meine ganz persönlichen Erfahrungen. Sie sind die Fortsetzung zu diesem Beitrag.
6. Mir selbst etwas verbieten
Genauso, wie ich versuche, die Bedürfnisse meiner Schüler/innen zu achten, versuche ich das auch mit meinen eigenen. Thema Essen: Ich werde meistens ziemlich ungemütlich, wenn ich Hunger habe. Angenommen, in der Pause ist keine Zeit zu frühstücken (wegen Staus am Kopierer, dringender Anrufe, Gesprächsbedarf mit Kollegen usw.) – statt in der Folgestunde mit knurrendem Magen und sinkender Laune weiter zu unterrichten, nutze ich Momente, in denen meine Gruppe still für sich arbeitet, und beiße schnell mal von meinem Brötchen ab. Ich kündige das an, sodass alle wissen, dass ich kurz nicht reden kann.
Das hat bisher gut gekappt. Ich glaube: Wenn junge Menschen merken, dass ihre eigenen Bedürfnisse gesehen und respektiert werden, können sie auch entspannt reagieren, wenn es um die Bedürfnisse anderer Personen geht. Es ist kein Kampf um „wer bekommt mehr“, kein entweder (meine Bedürfnisse) oder (die des anderen), so wie ich es früher in Klassen oft erlebt habe. Zugegeben: je größer die Klasse, desto schwieriger das Unterfangen „gegenseitige Bedürfnisse berücksichtigen“. Darum plädiere ich ja auch für kleinere Klassen (oder gar keine fixen Klassenverbände mehr).
Denn natürlich springt der Gerechtigkeitssinn an, wenn bestimmte Schüler/innen etwas machen dürfen und andere nicht, oder wenn ich als Lehrerin etwas tue, was anderen nicht gestattet ist. Wenn Bedürfnisse nicht gleich gewichtet werden, fühlen sich diejenigen am kürzeren Hebel vernachlässigt. Dass junge Menschen auch mal lernen müssen, ihre Bedürfnisse (z.B. gegenüber Erwachsenen) zurückzustellen, halte ich indessen für einen Irrtum. Doch zum Thema Adultismus an anderer Stelle mehr…
7. Versuchen, Persönliches geheim zu halten
Die „professionelle Distanz zu seinen Schülern wahren“, welcher Lehramtsstudent bekommt diese Regel nicht eingebläut?! Jahrelang habe auch ich versucht, nach diesem Credo zu handeln. Ich versuchte, möglichst professionell-distanziert rüberzukommen, und wenn mir doch mal das ein oder andere private Detail über die Lippen rutschte, hatte ich ein schlechtes Gewissen. Was für ein Quatsch!
Wenn ich zu jungen Menschen eine Beziehung aufbauen möchte – und ich bin überzeugt, dass Lernen am besten in und über Beziehung funktioniert – klappt das so garantiert nicht.
Nicht nur, dass es wahrscheinlich viele bemerken und irritiert, wenn ich mir so eine Maske aneigne, sondern auch, weil diese Pseudo-Distanz ein unnatürliches Ungleichgewicht mit sich bringt. Schließlich weiß ich als (Klassen-)Lehrerin alles Mögliche über meine Schüler/innen: wo diese wohnen, aus was für einem Elternhaus sie stammen, wo ihre individuellen Stärken und Schwächen liegen (jedenfalls laut Zeugnis). Die Schüler/innen wissen von mir erst einmal gar nichts. Ich kann entscheiden, wieviel und was ich preisgebe, die jungen Menschen haben diese Option in der Regel nicht. Diese „Informationshoheit“, die durch die schulischen Anmeldeverfahren bedingt ist, erschafft ein seltsames Machtgefälle: Ich weiß „alles“ von dir, aber du „nichts“ von mir. Das ist kein Boden für gesunde Beziehungen.
Kein Wunder also, dass viele Schüler/innen regelrecht danach lechzen, private Dinge von ihren Lehrern zu erfahren. Warum ist das so? Es geht um Beziehung. Und die Bedingung für ein in-Beziehung-sein ist Authentizität. „Ah, du bist so und so“ – sich kennen schafft Sicherheit und Vertrauen. Junge Menschen wollen sehen, wer hinter der „Lehrer-Maske“ steckt. „I want to see teachers as who they are“, sagt Paola Murdolo, ehemalige Schülerin einer demokratischen Schule.
Gelingt das trotz „professioneller Distanz“? Mir gelang es jedenfalls nicht. Mein Verhalten früher grenzte an Selbstverleugnung. Denn: Ich bin gar nicht distanziert. Ich liebe es, zu erfahren, wie andere Menschen leben, und genauso bereitwillig erzähle ich von meinem eigenen Leben. Ich quatsche gerne drauflos, bin offen, neugierig und lache viel. Warum all diese Facetten von mir verbergen?
„Echt“ sein bedeutet aber auch, bestimmte Dinge, die ich für mich behalten möchte, für mich zu behalten. Und natürlich Schüler/innen ihren eigenen Raum und Privatsphäre zu gewähren.
„Ich will nicht die beste Freundin meiner Schüler sein“, las ich jüngst in einer Kolumne einer Lehrerin. Das ist auch nicht meine Intention. Ich versuche jedoch nicht mehr, vertrauensvolle Beziehungen mit allen Mitteln zu unterbinden. Denn Distanz ist keine Bedingung für Professionalität.